Verstanden werden
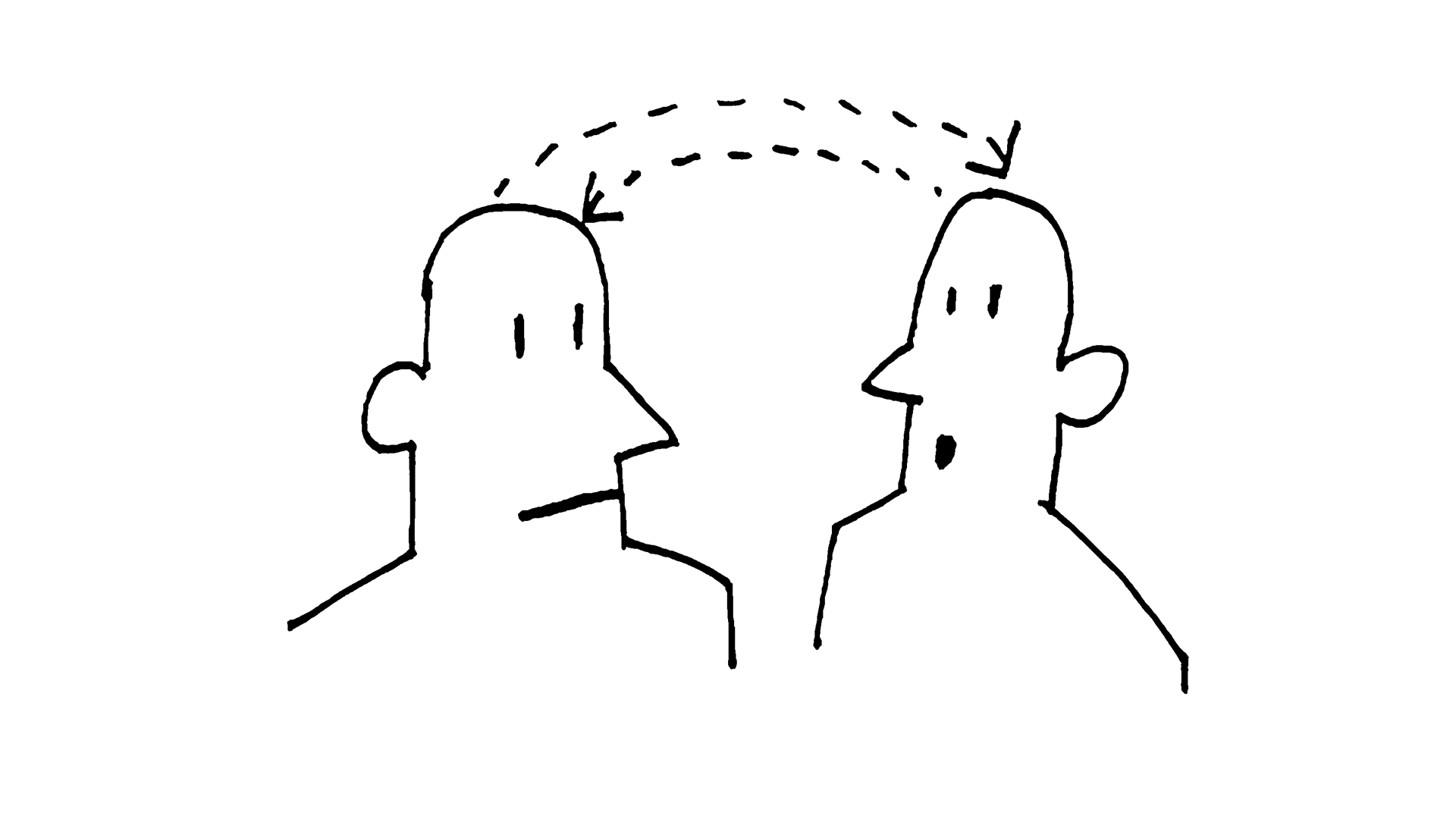
Zeitgenössische Kunst – d. h. Kunst, die das aktuelle kulturelle, gesellschaftliche und politische Klima auf der ganzen Welt widerspiegelt und ein breites Spektrum von Medien umfasst – hat ihre eigene Sprache, ihren eigenen Jargon, genau wie andere Bereiche menschlicher Tätigkeit. Wie in vielen anderen Disziplinen hilft die Fachsprache in der Kunst allen Beteiligten, Zeit zu sparen; Dinge müssen nicht erklärt werden, und wer Expert:in werden will, muss erst in diese Sprache eingeweiht werden. Die Fach- oder Wissenschaftssprache hat jedoch auch ihre Kehrseite. Manchmal ist sie ihre eigene Legitimation – ein Zweck statt ein Mittel. Das Problem der zeitgenössischen Kunst ist, dass sie sehr oft mit einer Fachsprache agiert, auch wenn sie sich an Laien wenden soll, was eine elitäre oder entfremdende Wirkung hat. In öffentlichen Einrichtungen wie Museen gibt es ganze Abteilungen, die sich mit der „Übersetzung“ der Fachsprache der zeitgenössischen Kunst befassen (z. B. Vermittlungs-, Publikumsentwicklungs- und Bildungsabteilungen). Es ist symptomatisch für diese Situation, dass diese Abteilungen in der Hierarchie der Institution oft einem künstlerischen und kuratorischen Programm untergeordnet sind, in das sie in den meisten Fällen in keiner Weise eingreifen können.
Für die Biennale Matter of Art 2024 haben sich die Kurator:innen und wir von tranzit.cz auf eine gemeinsame Regel geeinigt: die Biennale in allgemein verständlicher Sprache zu kommunizieren, nicht im Fachjargon. Die Biennale fand in der Nationalgalerie Prag statt, einer großen staatlichen Einrichtung im Stadtzentrum, die im Sommer nicht nur von Einheimischen, sondern auch von kulturbegeisterten Tourist:innen besucht wird. Von Tourist:innen kann man nicht erwarten, dass sie Kunstexpert:innen sind, aber oft fehlen ihnen auch die nötigen Kenntnisse der tschechischen oder englischen Sprache. Daher wurden die englischen Texte, die die Kurator:innen für die ausgestellten Werke verfasst haben, mit der Absicht redigiert, sie sprachlich zu vereinfachen. Eine Person mit Erfahrung im Unterrichten der englischen Sprache und im Übersetzen, und mit Kunstexpertise, hatte dabei das letzte Wort. Die Texte mussten für Menschen mit durchschnittlichen Englischkenntnissen verständlich sein und durften keine Fachbegriffe enthalten, die man nachschlagen müsste. Die so bearbeiteten Texte stießen bei den Kurator:innen und Künstler:innen auf Widerstand. Eine der Kurator:innen und einige der Kunstschaffenden waren der Meinung, dass die Texte die von den Kunstwerken ausgedrückten Ideen nivellierten und verflachten, obwohl wir der Meinung waren, dass wir die Bedeutung der Texte nicht verändert hatten. Mit den Kurator:innen haben wir dann ein Monat damit verbracht, über die Texte zu verhandeln. Letztendlich waren die Texte zu den Kunstwerken ein Kompromiss, weder völlig zugänglich noch absolut fachkundig. Letztendlich spiegelten sie die Spannungen wider, mit denen wir uns die ganze Zeit auseinandergesetzt hatten.
In den Diskussionen wurde deutlich, dass „verstanden werden“ für manche Menschen bedeutet, sich empathischer in die Leser:innen oder Rezipient:innen des Textes hineinzuversetzen. Für andere war es wichtiger, dass die Texte ihre Ideen präzise ausdrücken und genau die richtigen Begriffe verwenden. Ein Beispiel dafür ist eine Künstlerin namens Sráč Sam (Fucker Sam), mit der wir als tranzit zusammenarbeiten. Sam hat von vornherein Vertrauen in ihre Kunst und in die Menschen, und sie möchte weder Vermutungen darüber anstellen, was die Menschen verstehen oder nicht verstehen könnten, noch ganz bewusst versuchen, richtig verstanden zu werden. In ihrem Werk I Promise jedoch fordert sie ihr Publikum auf, ein Dokument zu unterschreiben, in dem es sein Vertrauen in die Kunst erklärt und dafür ein Stück ihres Werks erhält. Der Wunsch und die Absicht, verstanden zu werden, kann sich auf verschiedenste Art und Weise äußern, sogar in der ostentativen Weigerung, Zugeständnisse zu machen, damit man von anderen verstanden wird.
Sprache ist in das soziale Gefüge eingebettet; die Sprache, die wir verwenden, spiegelt unseren soziokulturellen und klassenspezifischen Status wider. Die Sprache des Kunstbereichs spiegelt den soziokulturellen Status der Menschen wider, die in diesem Bereich tätig sind. Als wir eines unserer Bücher mit dem Laundry Collective besprachen, einem Kunstkollektiv, dessen Mitglieder Erfahrungen mit Obdachlosigkeit und dem Leben auf der Straße haben, und wir den Begriff „Sexarbeiterinnen“ erwähnten, bekamen sie einen Lachanfall. Sie fragten uns: „Meint ihr Nutten?“ Einmal luden wir einen Roma-Aktivisten, einen Mann aus der Arbeiterklasse aus einer Kleinstadt, zu einer Spendenaktion in die Hauptstadt ein, um die basisdemokratische Initiative zu unterstützen, an der er beteiligt war. Zu der Veranstaltung waren vor allem junge Linke gekommen, die über seine Sprache schockiert waren. Einige von ihnen hatten den Eindruck, dass der Roma-Aktivist die Sprache rassistischer Politiker:innen benutzte.
In Aktivist:innen-, Akademiker:innen- oder Kunstschaffendenkreisen ist man oft sehr vorsichtig mit der Sprache, die man im Hinblick auf die Gefühle und das Selbstbestimmungsrecht der Personen, die man anspricht, benutzt. Man hütet sich davor, mit Worten Schaden anzurichten. Die Position, von der aus ich spreche, ist mit Sicherheit ein Faktor für den Sprachgebrauch. Wenn ich ein potenziell anstößiges Wort benutze, um meine eigene Wirklichkeit zu beschreiben, ist das sicherlich etwas anderes, als wenn ich eine Wirklichkeit beschreibe, die ich nicht erlebe. Kommunikation ist jedoch ein dynamischer Prozess. Das (Miss-)Verständnis hängt zunächst einmal von der Situation und den Bedingungen ab, in denen wir uns befinden. In bestimmten Situationen neigen wir dazu, andere nicht verstehen zu wollen – zum Beispiel in den sozialen Medien oder generell unter Bedingungen, die wir als uns gegenüber feindlich empfinden. In anderen Situationen – z. B. bei einem persönlichen Treffen oder in einem Kontext, der das gegenseitige Verständnis erleichtert – ist dies eher möglich. Können wir daraus für die von uns organisierten Veranstaltungen oder Programme lernen?
In der Kunstwelt sollte es Platz für „Nutten“ und „Sexarbeiterinnen“ geben, einen Ort, an dem Menschen über Klassen- oder andere Grenzen hinweg kommunizieren können. Mit anderen Worten: In der Kunst sollte es gleichermaßen Raum für Diskussionen und Spannungen geben. Die Sprache sollte divers sein. Am schlimmsten ist es, wenn es nur eine Sprache gibt – die Fachsprache, die in Drinnen und Draußen unterteilt. Es ist in Ordnung, nicht zu verstehen und nicht verstanden zu werden, Fehler zu machen oder verwirrt zu sein, aber dieses Missverständnis sollte ein Mittel sein, ein Portal, keine Sackgasse. Es ist in Ordnung, wenn wir einander nicht verstehen, aber es sollte unser Ausgangspunkt für die Suche nach neuen Worten und einer neuen Sprache sein, einer Sprache, die über die Unterschiede hinweg eine Brücke zu anderen schlägt.